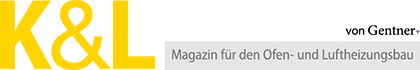OekoSolve, seit Kurzem Mitglied der EFA, empfing die Teilnehmenden in den eigenen Produktionsräumen und bot damit den idealen Rahmen für eine Veranstaltung, die Fachwissen, Praxisnähe und europäische Perspektive miteinander verband. Die Begrüßung übernahm EFA-Vorstandsmitglied Jürgen Böhm, die Moderation lag bei Dr. Johannes R. Gerstner.
Bereits der erste Vortrag machte deutlich, wie stark technologische, gesellschaftliche und politische Dimensionen in der Luftreinhaltungsdebatte ineinandergreifen. Bernd Weishaar, Repräsentant von OekoSolve und Vorstandsvorsitzender der Clean Exhaust Association (CEA), stellte die Ergebnisse einer aktuellen CEA-Studie zur Feinstaubsituation in der Schweiz vor. Sie zeigt, dass elektrostatische Staubabscheider in Holzfeuerungen nicht nur technisch wirksam, sondern auch ökonomisch sinnvoll eingesetzt werden können. Bei typischen Haushaltsanlagen ließen sich die Feinstaubemissionen um bis zu 13 Prozent zusätzlich reduzieren – ein relevanter Beitrag zur Erreichung nationaler und europäischer Luftqualitätsziele.
Weishaar erläuterte, dass die Schweiz mit ihrer konsequenten Messpraxis und hohen Datenqualität ein Vorbild für viele europäische Länder darstellt. Die Akzeptanz solcher Technologien stehe jedoch in engem Zusammenhang mit politischen Rahmenbedingungen: Nur dort, wo saubere Verbrennungssysteme durch Anreizprogramme, Fördermechanismen oder bauordnungsrechtliche Anerkennung unterstützt werden, entfalte sich ihr volles Potenzial. Er plädierte dafür, emissionsarme Systeme künftig gezielt zu fördern und Forschung wie auch Marktanwendung stärker miteinander zu verknüpfen.
Im Anschluss gaben Dr. Josef Wüest und Tom Strebel, Leiter der Prüfstelle, beide bei der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) einen tiefen Einblick in den Stand der Forschung und Prüfpraxis. Beide untersuchen dort das Verhalten moderner Einzelraumfeuerstätten unter realen Betriebsbedingungen. Ihr Beitrag machte deutlich, dass die Anforderungen an Prüfstellen und Hersteller in Zukunft deutlich steigen werden. Durch neue Regelwerke wie die EU-Bauprodukteverordnung und die geplante Überarbeitung der Ecodesign-Verordnung werden Lebenszyklusanalysen, Recyclingfähigkeit und digitale Produktpässe zentrale Kriterien in der Bewertung von Feuerungsanlagen.
Anhand aktueller Versuchsdaten zeigten sie, wie moderne Verbrennungsregelungen, gestufte Luftzuführung und adaptive Sensorik Emissionen deutlich reduzieren können. Besonders im Fokus standen Entwicklungen wie der „Mikro-Pellet-Ofen“ und die Optimierung von Holzgasbrennern mittels CFD-Simulationen. Wüest und Strebel betonten, dass eine realistische Prüfmethodik – die sowohl Brennstoffvariabilität als auch unterschiedliche Lastzustände abbildet – künftig entscheidend sein wird, um die Praxistauglichkeit technischer Grenzwerte sicherzustellen. Gleichzeitig forderten sie eine stärkere Harmonisierung der europäischen Prüfnormen, um Vergleichbarkeit und Innovationsspielraum zu sichern.
Für den behördlichen Blick auf das Thema sorgte Beat Müller vom Schweizer Bundesamt für Umwelt (BAFU). In seinem Vortrag zeigte er, wie konsequent die Schweiz ihre Luftreinhaltepolitik an wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausrichtet. Mit der geplanten Senkung der Grenzwerte für Feinstaub (PM2.5 und PM10) rückt die Gesundheitsvorsorge noch stärker in den Vordergrund. Müller stellte dar, dass Holzfeuerungen zwar einen nennenswerten, aber zugleich technisch gut adressierbaren Anteil an den Feinstaubemissionen haben. Die Schweizer Strategie kombiniere deshalb technische Innovation, kommunale Vollzugsstärke und eine breite Sensibilisierung der Bevölkerung.
Besonderes Interesse fanden die Vergleiche zwischen der Schweizer Praxis und den in Deutschland geltenden Regelungen. Während in der Schweiz die Kantone eine aktive Rolle bei der Emissionsüberwachung einnehmen, setzen deutsche Behörden stärker auf Typprüfung und Grenzwertkontrolle. Müller hob hervor, dass beides zusammenwirken müsse, um nachhaltige Effekte zu erzielen – und dass internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich weiter an Bedeutung gewinnt.
Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die anschließende Führung durch die Produktionsstätten von OekoSolve. Die Teilnehmenden konnten sich vor Ort ein Bild von der Fertigung der elektrostatischen Staubabscheider machen – von der Gehäusebearbeitung bis zur Qualitätsprüfung der fertigen Module. Viele zeigten sich beeindruckt von der hohen Fertigungstiefe und der Präzision der Prozesse. Der Rundgang bot einen anschaulichen Einblick in die Verbindung von Ingenieurwesen, Handwerk und Umwelttechnik, die für die Branche zunehmend prägend ist.
Am zweiten Tag trat die EFA-Mitgliederversammlung zusammen. Nach der Eröffnung durch Jürgen Böhm berichtete Dr. Johannes R. Gerstner über die laufenden Aktivitäten des Verbandes. Er ging auf die aktuelle politische Lage und auf europäische Konsultationen zu Ecodesign und Luftreinhaltevorgaben ein. Dabei betonte er die Notwendigkeit, Fachwissen und technische Fakten stärker in politische Entscheidungsprozesse einzubringen. Die EFA werde diesen Dialog weiterführen – mit sachlicher Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen und dem gezielten Austausch zwischen Industrie, Wissenschaft und Behörden.
Anschließend informierte Dirk Böhringer über den Stand der Arbeiten an der europäischen Norm DIN EN 16510, die zentrale Anforderungen für Einzelraumfeuerstätten definiert. Die laufende Überarbeitung befinde sich derzeit in der Konsolidierungsphase, erklärte Böhringer. Dabei gehe es um redaktionelle und methodische Anpassungen, die in mehreren Mitgliedstaaten abgestimmt werden müssen. Er unterstrich, dass künftige Änderungen technologieneutral und praxistauglich bleiben sollten, um Innovationen nicht zu behindern. Für das Frühjahr 2026 kündigte er ein Technik-Update an, bei dem die Mitglieder über mögliche Auswirkungen und Fristen informiert werden.
Zum Abschluss dankte Jürgen Böhm der OekoSolve AG für die Gastfreundschaft und den Teilnehmenden für den intensiven Austausch. Die zweitägige Veranstaltung habe gezeigt, dass Forschung, Regulierung und Praxis zunehmend enger zusammenarbeiten.
Die EFA-Herbsttagung 2025 machte deutlich, dass die Branche vor einer neuen Phase der technischen und politischen Integration steht: Luftreinhaltung, Klimaschutz und Energieeffizienz werden künftig noch stärker gemeinsam gedacht werden müssen. Mit ihrem Netzwerk aus Industrie, Forschung und Behörden bietet die EFA dafür eine zentrale Plattform – als Ort des fachlichen Austauschs, der Vernetzung und des praxisorientierten Dialogs. Die nächste Tagung wird aller Voraussicht nach am 23. April 2026 in Leipzig stattfinden.